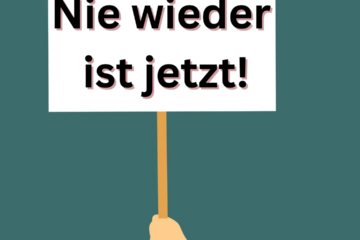Wie sozial ist die Verfassung des Landes Baden-Württemberg?
Das Grundgesetz ist Verfassung für das gesamte deutsche Bundesgebiet. Es schreibt vor, dass die Länder selbst im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verfasst sein müssen, dass ihr Verfassungsrecht auch durch entgegenstehendes einfaches Bundesrecht überlagert wird und welche sachlichen Kompetenzen sie haben. Innerhalb dieses Rahmens können die Länder Konkretisierungen vornehmen und eigene Leitlinien bestimmen. Da die grundgesetzlichen Grundrechte hauptsächlich der Abwehr staatlicher Eingriffe dienen, erscheint der Gestaltungsspielraum hinsichtlich sozialer Teilhabe- und Leistungsrechte erweitert. Dieser Beitrag analysiert Umfang, Effektivität und Erweiterungsmöglichkeiten solcher Regelungen innerhalb der Landesverfassung Baden-Württembergs. Ein Beitrag von Nikitas L. Rischkowsky (KV Stuttgart).
In Art. 23 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 Satz 1 bekennt sich die Verfassung des Landes Baden-Württemberg, genau wie das Grundgesetz, zu einem unveräußerlichen Sozialstaatsprinzip. Gehalt dessen ist die Erhaltung der Grundlage gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Teilhabe an diesem. Dem ist durch gleichmäßige und bestmögliche Daseinsvorsorge Rechnung zu tragen. Darüber hinaus wird in Art. 2 Abs. 1 auf die grundgesetzlichen Grundrechte verwiesen. Insbesondere betrifft dies die Menschenwürde, aus welcher sich auch ein Anspruch auf den Erhalt des Existenzminimums ergibt, das Diskriminierungsverbot als Grundlage für Rechtsgleichheit und Bedürfnisgerechtigkeit, den Schutz der Familie als Grundlage gegenseitiger Unterstützung innerhalb der Gesellschaft, das Koalitions- und Arbeitskampfrecht sowie die Eigentumsgarantie mit ihren Einschränkungsvorbehalten der Sozialbindung und gemeinwirtschaftlichen Verwertung.
Ergänzend beinhaltet die Landesverfassung in Art. 11 Abs. 1 ein Recht auf Bildung, welches im Bundesverfassungsrecht nur kraft richterlicher Rechtsfortbildung besteht und entsprechend nicht unumstritten ist. Daraus ergibt sich ein Anspruch auf eine der individuellen Begabung und den Bedürfnissen entsprechende Erziehung und Ausbildung, unabhängig der Herkunft und wirtschaftlichen Lage. Davon umfasst ist auch der gleiche Zugang zum Studium nach sachlichen und auch für individuell Benachteiligte zumutbaren Kriterien. Ferner schützt die Norm vor Einschränkungen des bestehenden Bildungssystems. Zudem garantieren die Art. 6 und 87 den Erhalt der Wohlfahrtspflege von Religionsgemeinschaften und anderen nichtstaatlichen Trägern, sodass die Daseinsvorsorge institutionell zusätzlich abgesichert ist.
Die benannten Grundrechte sind sowohl für die Ausformung des Sozialstaatsprinzips im Recht als auch dessen tatsächliche Entfaltung von hoher Bedeutung. Wären sie nicht ausdrücklich verrechtlicht, bliebe das Prinzip in Landesverfassung und Grundgesetz zunächst bloßer Begriff. Als solcher wäre es der nahezu unbegrenzten Auslegung durch den Adressaten, die Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung, zugänglich. Allenfalls ließe sich ein Handlungsauftrag zur Auflösung sozialer Spannungen entnehmen, nicht aber konkrete Aufgaben des Staats oder Rechte seiner Bürger. Diese ergeben sich erst aus dem Zusammenwirken der Gewährleistungsgehalte. Seit 2013 ist auch die unmittelbare Geltendmachung von der Landesverfassung eigenen und inkorporierten Grundrechten durch den im Einzelfall Beeinträchtigten im Wege einer Landesverfassungsbeschwerde möglich, ihre Effektivität wurde so weiter erhöht. Ob auch eine den Rechten zuwiderlaufende staatliche Untätigkeit tauglicher Beschwerdegegenstand sein kann, ist im Kontext der Landesverfassungsbeschwerde jedoch umstritten.
Eine noch weitergehende grundrechtliche Ausformung ist denkbar. Anhand der folgenden Beispiele lassen sich jedoch auch die Grenzen des Landesverfassungsrechts aufzeigen. Die Verfassungen der vor der Vereinigung zu Baden-Württemberg 1952 auf dem Landesgebiet bestehenden Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern enthielten ein Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer in ihren Betrieben. Dieses würde aber inzwischen insbesondere durch das Betriebsverfassungsgesetz überlagert. Zudem forderten die drei Verfassungen die gleiche Achtung von häuslicher Arbeit (sog. Care-Arbeit) und Erwerbsarbeit. Die Norm ist aber so unbestimmt, dass sie den Staat kaum zum Erlass von Regelungen, die über das Recht zur Teilhabe am in der Ehe erwirtschafteten aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch hinausgehen kann. In Baden war außerdem ein Recht auf Arbeit vorgesehen. Ein solches findet sich weiterhin in einigen deutschen Landesverfassungen, beispielsweise in Hessen. Trotz klarer Formulierung leitet der hessische Staatsgerichtshof aber aus dem Recht auf Arbeit keinen Anspruch auf einen qualifikationsentsprechenden Arbeitsplatz ab, sondern nur eine Pflicht des Staats, sein Handeln auf die Minimierung von Arbeitslosigkeit zu richten. Er könne sich nur so weit verpflichten, wie er zu leisten im Stande sei.
Folglich sind die punktuellen grundrechtlichen Konkretisierungen des Sozialstaatsprinzips in der Verfassung Baden-Württembergs als solche effektiver. Erweiternd wäre es lediglich möglich, die Leitlinien der Sozialpolitik sowie die Auslegung des Arbeits- und Sozialrechts verfassungsrechtlich enger zu bestimmen. Eine selbstständige Geltendmachung dessen durch den Bürger bliebe aber ausgeschlossen, auch dann wäre er auf den Aktivismus der unmittelbar am Verfassungsleben Beteiligten angewiesen. So hat der Landesverfassunggeber seine begrenzten Möglichkeiten jedenfalls in dieser Hinsicht weitgehend ausgenutzt.

Literaturhinweise:
Feuchte, Paul: Verfassungsgeschichte von Baden-Württemberg, Stuttgart, 1983.
Haug, Volker (Hrsg.): Verfassung des Landes Baden-Württemberg (Handkommentar), Baden-Baden, 2018.
Peine, Franz-Joseph: Verfassunggebung und Grundrechte – der Gestaltungsspielraum der Landesverfassunggeber, LKV 2012, S. 385 ff.
Rausch, Jan-Dirk: Ein Grundgesetzle mit verpassten Chancen – 70 Jahre Landesverfassung Baden-Württemberg, BLBlog vom 20.11.2023.