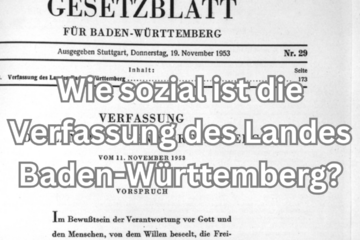‚Law and Order‘ ist kein Grundwert
Da ist er nun, der Koalitionsvertrag. Ähnlich schwierig wie die Verhandlung dürfte die Entscheidung werden, die jeder von uns in den kommenden Tagen treffen muss: Stimme ich zu? Eine große Frage, aber irgendwo muss man ja anfangen und für mich war der natürliche Einstieg, mir die Kapitel zu Innen und Recht anzuschauen.
Mein erster Gedanke beim Lesen dieses Kapitels war, dass ich aus Versehen ein CDU-Wahlprogramm geöffnet haben muss. Leider nicht. Und weil geteiltes Leid nun mal halbes Leid ist oder so, lasse ich euch nun an den desaströsen Vorhaben im Koalitionsvertrag teilhaben.
Dabei präsentiere und erkläre ich euch nicht nur die problematischsten Punkte, sondern stelle vor allem die Fragen, wie es zu einem so konservativen und populistischen, allein auf ‚Law and Order‘ fokussierten Ergebnis kommen konnte und was für uns Jusos jetzt zu tun ist.
Innere Sicherheit im Koalitionsvertrag: Populistisch, gefährlich, wirkungslos
Der Koalitionsvertrag setzt bei der inneren Sicherheit vor allem auf zweierlei: Einerseits und vor allem soll das Strafrecht und Strafprozessrecht ausgeweitet und verschärft werden. Andererseits soll das Gefahrenabwehrrecht verändert werden, was sich insbesondere in umfassenderen Befugnissen für Polizei und Geheimdienste niederschlägt. Entkriminalisierungen sind dagegen Nebensache und von evidenzbasierter Kriminalpolitik hat man sich gleich ganz verabschiedet.
Ausweitung und Verschärfung des Strafrechts
Kaum etwas ist bei Innenpolitiker:innen so beliebt wie die Forderung nach neuen Strafgesetzen oder höheren Strafen. Was auch immer passiert: Auf eine Welle der Empörung mit solchen Forderungen zu reagieren, schadet nie. So auch hier, immerhin haben die während des Wahlkampfes aufgetretenen medienwirksamen Straftaten einige Vorlagen geliefert. So möchte man zum Beispiel § 89a StGB (Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat) verschärfen, indem auch mit Alltagsgegenständen begangene Taten erfasst werden. Das klingt zunächst plausibel, immerhin können insbesondere Fahrzeuge ähnlich gefährlich sein wie Sprengstoff. Denkt man allerdings über die Auswirkungen für die Ermittlungspraxis nach, sollte einem schnell auffallen, dass „Alltagsgegenstände“ ja alles sein können und folglich ein Anfangsverdacht und darauffolgende Durchsuchungen oder Abhörmaßnahmen quasi frei Schnauze erfolgen können.
Außerdem mutet es etwas fragwürdig an, Kriminalprävention (also das Verhindern von Straftaten) vor allem mithilfe des Strafrechts zu verfolgen (das eigentlich dazu da ist, bereits geschehene Straftaten zu bestrafen). Dieses Vorgehen ist allerdings kein Einzelfall, sondern Kernelement des Koalitionsvertrags.
So zum Beispiel beim Thema Gewalt gegen Frauen (die Begrifflichkeit entstammt dem Koalitionsvertrag), das – auf den ersten Blick erfreulich – einen größeren Absatz füllt. Frauen und „besonders verletzliche Personen“ sollen besser geschützt werden. Allerdings bestehen die dafür vorgeschlagenen Maßnahmen (bis auf eine) allein in der Erhöhung von Strafen für einige Straftaten (bestimmte Fälle von Vergewaltigung, Tötungsdelikten, gefährlichen Körperverletzungen, Raub). Jetzt ist in der Kriminologie, also die Wissenschaft, die sich mit Kriminalität und den gesellschaftlichen Reaktionen darauf beschäftigt, ja vieles unklar und heiß diskutiert. Aber eins ist recht unumstritten: Höhere Strafen sorgen nicht dafür, dass weniger Straftaten begangen werden.

Man kann die aufgeführten Taten gegen Frauen* besonders verwerflich finden und daher höhere Strafen fordern. Aber zu behaupten, dass durch sie weniger Gewalt gegen Frauen* auftreten würde, entbehrt jeglicher Grundlage, widerspricht sogar den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und da die Strafverschärfungen den allergrößten Teil der vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen ausmachen, enthält das Kapitel also doch kaum konkrete Maßnahmen zur Verminderung von Gewalt gegen Frauen – schade, aber das ist die Konsequenz, wenn wirkungslose Symbolpolitik potenziell effektive Interventionen verdrängt.
Vor dem Hintergrund der Nutzlosigkeit höherer Strafen ist auch die geplante Strafverschärfung bei Angriffen gegen Rettungskräfte und Polizei zu kritisieren. Hier kommt hinzu, dass dieses Vorhaben bereits 2017 umgesetzt wurde, offenbar aber keine Wirkung gezeigt hat. Kein Wunder, immerhin bestätigt das nur, was die Wissenschaft seit Jahren predigt. Aber sei’s drum, was beim ersten Mal schief geht, wird beim zweiten Mal bestimmt funktionieren.
Ermittlungsbefugnisse bis zur Grenze der Verfassungswidrigkeit
Bei den Ermittlungsbefugnissen muss man gar nicht ins Detail gehen, um den populistischen Charakter der Maßnahmen herauszuarbeiten – das Koalitionspapier beschreibt selbst äußerst anschaulich, wohin die Reise gehen soll:
„Wir werden die europa- und verfassungsrechtlichen Spielräume ausschöpfen, um ein Höchstmaß an Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Das Spannungsverhältnis zwischen sicherheitspolitischen Erfordernissen und datenschutzrechtlichen Vorgaben muss deshalb neu austariert werden.“ (Z. 2623 ff.)
Übersetzt also: Ermittlungsbefugnisse werden zulasten der Grundrechte, insbesondere des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, bis an die Grenze der Verfassungswidrigkeit eingeschränkt. Das ist doch mal eine Ansage. Dass das problematisch ist, dürfte klar sein. Es lohnt sich trotzdem, darauf hinzuweisen, dass erweiterte polizeiliche Befugnisse im Zweifel vor allem denjenigen schaden, die sowieso schon überdurchschnittlich von der Polizei drangsaliert werden: Vor allem sozioökonomisch nicht privilegierte und migrantisch gelesene Menschen.
Außerdem sollte man sich bei Datenkraken- und Überwachungsstaat-Projekten wie ausgeweiteter Videoüberwachung, umfassenden und behördenübergreifenden Datenbanken und KI-gestützten Auswertungen von Daten nicht nur die teils beachtlichen Schwachstellen der jeweiligen Technologien vor Augen führen. Besonders seit der letzten Bundestagswahl muss auch und vor allem in Betracht gezogen werden, wie diese Instrumente durch mögliche zukünftige Regierungen unter AfD-Beteiligung missbraucht werden könnten. Jedes Instrument, das die demokratische Mitte heute schafft, kann – und wird – gegen sie verwendet werden.
Generalverdacht gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen
Bedauerlicherweise hat auch die hochproblematische Formulierung, man solle im Rahmen eines „behördenübergreifenden Risikomanagement“ die „Risikopotenziale“ von „Personen mit psychischen Auffälligkeiten“ überwachen, die Verhandlungsphase überstanden. Wie genau das passieren soll, bleibt offen, aber mir will keine Option einfallen, bei denen nicht alle Menschen mit psychischen Erkrankungen unter Generalverdacht gestellt und ihre Daten von Sicherheitsbehörden gesammelt werden. Kriminalität mit psychischen Erkrankungen im Allgemeinen gleichzusetzen ist bereits evidenzwidrig und schäbig genug; noch abgründiger erscheint das Ganze aber, sobald man merkt, dass der Koalitionsvertrag zum Schutz psychisch kranker Menschen und zur Bereitstellung von Therapieplätzen kaum etwas zu bieten hat.
(Keine) Abschaffung unnötiger Straftatbestände
Der einzige Punkt, der dem Trend der Ausweitung und Verschärfung des Strafrechts entgegenläuft, erstreckt sich auf gerade so zwei Zeilen: Zur Entfernung von überflüssigen Straftatbeständen ist allein ein Prüfauftrag vorgesehen. Dieser Punkt ist bereits in der Ampel nicht umgesetzt worden, dort allerdings noch als eines der Kernprojekte des Justizministeriums. Jetzt wird dem Projekt noch weniger Aufmerksamkeit gewidmet – einziger Lichtblick ist Sonja Eichwede, die als Justizministerin gehandelt wird und sich bereits in der Vergangenheit für die Streichung von z.B. § 265a StGB (Erschleichen von Leistungen, auch bekannt als Schwarzfahrparagraph) ausgesprochen hat.
Welche Sicherheit?
All diese Verschärfungen und die mit ihnen einhergehenden Grundrechtseingriffe erfolgen im Namen der Sicherheit. Aber was ist das eigentlich? Der Koalitionsvertrag hat keine Antwort, jede:r darf fröhlich assoziieren. Das ist angenehm, immerhin können auf einen so ungreifbaren Begriff alle Wünsche und Hoffnungen für ein angstfreies, zukunftsfreudiges Leben projiziert werden – oder eben alle Frustrationen, egal woher sie stammen mögen. Niemand fordert je weniger Sicherheit, also sind wir uns doch alle einig?
Leider (oder, für die Koalitionsparteien: zum Glück) lässt sich Sicherheit ohne konkrete Definition nicht evaluieren, sodass die Unwirksamkeit der vereinbarten Maßnahmen wohl nie medial wirksam diskutiert wird. Und wenn in einigen Jahren dann weiterhin ein Gefühl der Unsicherheit und hohe Kriminalitätsfurcht herrscht, kann das Strafrecht noch ein wenig verschärft werden. Für diese Erkenntnis ist keine Kristallkugel nötig, denn empirische Forschung zeigt uns, dass Kriminalitätsfurcht regelmäßig nicht mit der realen Sicherheitslage zusammenhängt, sondern ein Proxy für allgemeine, etwa ökonomische und statusbezogene Unsicherheit ist. Es ist also kein Zufall, dass Sicherheit auf über zehn Seiten Koalitionsvertrag als „Begründung“ für umfassende Kriminalisierungen und Grundrechtseingriffe angeführt wird, aber keinerlei inhaltliche Ausarbeitung erfährt – sondern Populismus in Reinform.
Eine neue Ehrlichkeit bei der inneren Sicherheit
Die Ampel behauptete im Koalitionsvertrag noch, evidenzbasierte Kriminalpolitik zu machen. Dieser Begriff ist im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD nicht aufzufinden. Das ist natürlich schade, andererseits muss man sich vielleicht über die neue Ehrlichkeit freuen. Wenn die Koalitionsparteien noch ein wenig ehrlicher sein wollten, könnten sie auch in den Koalitionsvertrag schreiben, dass sie sich populistischer Kriminalitätspolitik verschreiben.
Wie konnte es dazu kommen?
Hat sich die CDU also durchgesetzt? Ich glaube nicht. Erstens sind einige der destruktivsten Vorschläge der CDU, etwas die Herabsetzung der Altersgrenze für Strafbarkeit, nicht im Koalitionsvertrag enthalten. Besonders anschaulich war dies in den Zwischenständen der Verhandlung, in denen die CDU einige Punkte in blau als Wünsche hinterlegt hatte. Bezeichnenderweise gab es erheblich weniger rote Vorschläge der SPD. Das Problem ist also nicht, dass die CDU sich durchgesetzt hat, sondern dass wir kaum eigene Ideen für eine sozialdemokratische Sicherheitspolitik haben und im Übrigen dieselben Positionen vertreten wie die CDU. So überrascht es nicht, wenn die meisten der oben angesprochenen Punkte von den zuständigen Verhandlern der SPD als Kernanliegen der SPD verteidigt werden. Das ist übrigens nicht erst seit gestern der Fall – schon eine 2014 veröffentlichte Studie zur Strafgesetzgebung seit 1976 kam zu dem Ergebnis, dass zwischen SPD und CDU in Sachen innerer Sicherheit kaum ein Blatt passt.
Aber wieso hört unsere sozialdemokratische, im besten Fall auch sozialistische (Grüße gehen raus ans Grundsatzprogramm) Gesellschaftskritik bei innerer Sicherheit auf? Wir verurteilen Populismus bei der CDU/CSU und der AfD, bisweilen sogar bei den Linken, aber springen beim Thema innere Sicherheit fröhlich auf den Populismuszug auf und sind glückliche Passagiere nicht nur während der Wahlkämpfe, sondern auch in der Regierung.
Realpolitische Zwänge sind dabei nur eine billige Ausrede. Einerseits ist es kein Wunder, dass weder in den Medien noch in der „öffentlichen Meinung“ (falls das überhaupt etwas anderes ist als Medienberichte) Rufe nach einer progressiveren Kriminalitätspolitik laut werden: Wenn ein Thema von niemandem gesetzt wird, kann es auch nicht aufgegriffen werden. Einen treffend benannten „politisch-publizistischen (und populistischen) Verstärkerkreislauf“ gibt es aktuell eben nur für konservative Kriminalpolitik, nicht aber für progressive. Wir sind auch keineswegs allein mit dieser Kritik, denn die wird von Praktiker*innen durchaus geteilt. Diese kritischen Stimmen der Justizpraxis haben bisher keine politische Vertretung – gemeinsam mit ihnen können wir progressive Kriminalpolitik wieder auf die Agenda setzen.
Für ein sozialdemokratisches Verständnis von innerer Sicherheit
Aufmerksame Leser:innen werden mir inzwischen sicher vorwerfen, selbst auf unbestimmte und vielleicht auch unbestimmbare Begriffe zurückzugreifen. Was soll ein „sozialdemokratisches Verständnis von innerer Sicherheit“ denn auch sein? Ich weiß es nicht, habe aber einige Ideen, die allerdings einen eigenen Beitrag erfordern werden. So viel vorab: Ich bin davon überzeugt, dass es nicht populistisch sein darf und evidenzbasiert sein muss.
Das erfordert einigen Mut, denn die „Kultur der Kontrolle“ oder auch „Sicherheitsgesellschaft“, die sich etabliert haben, sind auch aus dem politischen Diskurs kaum noch wegzudenken und solche Einstellungen in der Bevölkerung, den Medien und bei fast allen anderen Parteien können auch nicht einfach ignoriert werden. Die vorherrschende populistische, evidenzwidrige und größtenteils symbolische Kriminalpolitik abzulehnen, darf nicht unser einziger Standpunkt sein; es wäre konsequent und inhaltlich richtig, aber politischer Suizid. Stattdessen brauchen wir einen genuin sozialdemokratischen Gegenentwurf mit einem eigenen Verständnis davon, was Sicherheit bedeutet. Wir brauchen eine verständliche Argumentation, wie wir dieses Ziel erreichen und eine nachvollziehbare Erzählung. Unsere Kriminalpolitik muss inhaltlich rational, evidenzbasiert und humanistisch sein. Sie darf sich aber nicht nur darauf beschränken, sondern muss den vorherrschenden populistischen Erzählungen und Emotionalisierungen auch auf diesen Ebenen etwas entgegensetzen. Gerade wir Jusos müssen dabei die Kosten von konservativer Sicherheitspolitik in den Mittelpunkt stellen: Für alle Bürger*innen, aber besonders die sozial nicht privilegierten Menschen, für migrantisch gelesene Personen und nicht cis-männliche Menschen.
Was ich hier beschreibe, ist kein einfaches Vorhaben, weder innerparteilich noch in der Gesamtgesellschaft. Gerade deswegen fällt es uns zu, hier einen Anstoß zu geben – etablierte Sicherheitspolitikern, deren Karrieren auf populistischer und wirkungsloser Symbolpolitik beruhen, werden es jedenfalls nicht tun. Im ersten Schritt müssen wir die oben aufgeworfenen Fragen für uns klären. Vielleicht erhaltet Ihr dazu noch einen Beitrag von mir, aber das wäre auch nur die Meinung einer Person. Vor allem möchte ich mit euch ins Gespräch kommen und vielleicht sogar eine kleine Initiative zu diesem Thema starten. Falls ihr Ideen zu dem Thema habt, euch Fragen gekommen sind, ihr Kritik an meiner Position teilen wollt oder ihr euch einer kleinen Arbeitsgruppe anschließen wollt, meldet euch auf Instagram (gidion.zieten).
Freundschaft
Gidion

Gidion Zieten ist Juso aus Freiburg. Dort arbeitet und promoviert er derzeit in den Bereichen Kriminologie und Strafrecht, nachdem er ein Masterstudium der Kriminologie in Kapstadt abgeschlossen hat. In seiner Forschung und politischen Arbeit beschäftigt er sich unter anderem mit der Frage, wie evidenzbasierte Kriminalpolitik in politische Prozesse eingebracht werden kann. Politisch war er bei den Jusos und der SPD in Heidelberg aktiv und hat dort die Hochschulgruppe der Kritischen Jurist*innen mitbegründet.
Hinweis: Das Beitragsbild wurde mithilfe von KI erstellt.